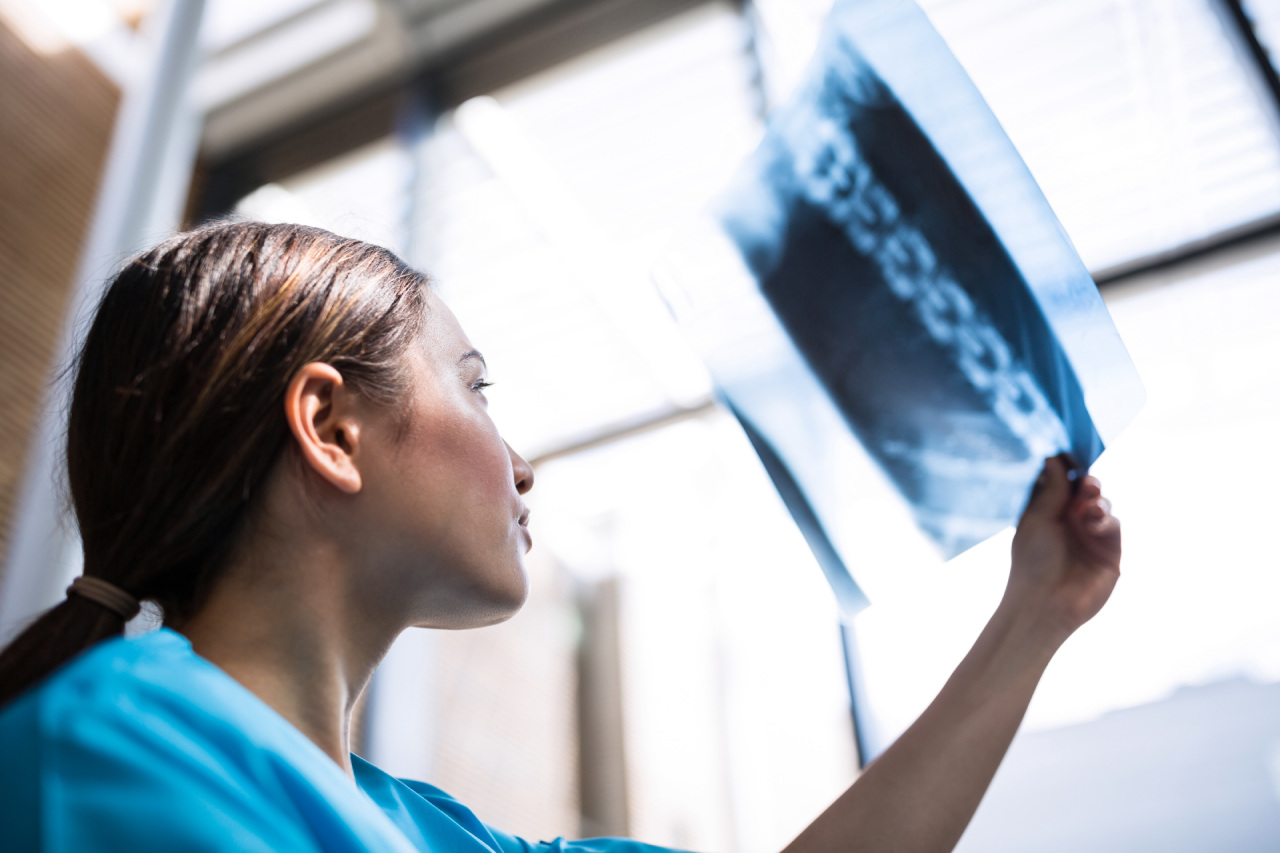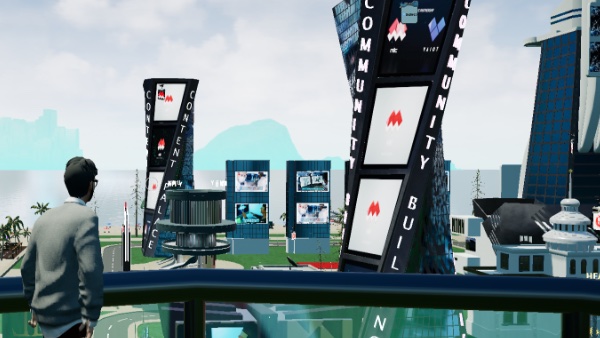Inhalt
„Denk nicht an Zebras!“
Ein logisches Prinzip, das auch bei der Suche nach Diagnosen häufig zur Anwendung kommt ist „Occams Rasiermesser“: Je weniger unbegründete Annahmen zur Erklärung eines Phänomens getroffen werden müssen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Erklärung zutrifft.
In Bezug auf Medizin bedeutet dies: Eine simple Erklärung oder häufige Erkrankung ist eine glaubwürdigere Diagnose als das Zusammentreffen seltener Zufälle und besonderer Komplikationen. Vereinfacht zusammengefasst wird dies oft als: „Beim Geräusch von Hufgetrappel soll man nicht zuerst an Zebras denken, sondern an Pferde.“
Das bedeutet nicht, dass Wissenschaftler oder Ärzte unwahrscheinliche Diagnosen generell ausschließen (oder ausschließen sollten). Aber es erklärt, warum bei der Behandlung von Symptomen zuerst die Wege ausprobiert werden, die am häufigsten Besserung versprechen. Dies ist auch ein ökonomisch sinnvolles Vorgehen: Warum sollte das Gesundheitssystem Ressourcen opfern, um alle Möglichkeiten auszuschließen und abzuklären, wenn in den meisten Fällen bereits simple Therapien den gewünschten Erfolg liefern?
Das ist auch, was gemeint ist, wenn Mediziner sagen „Wer heilt, hat recht“! Dabei geht es nicht um die Legitimation unwissenschaftlicher oder empirisch nicht haltbarer Heilmethoden. Stattdessen soll das Sprichwort zeigen, dass nicht diagnostische Feinheiten oder komplexeste Erklärmodelle das Nonplusultra der Medizin darstellen, sondern der Fokus immer auf dem Wohl des Patienten liegen muss.
Psychische Ursachen und ihr Einfluss auf die Diagnostik
Manche Krankheiten, die wir hier vorstellen, sind mit Stigmata versehen, die es Ärzten und Patienten erschweren, offen miteinander zu sprechen. Gerade psychische Erkrankungen sind ein für beide Seiten schwieriges Feld. Hausärzte, die die allermeiste Zeit mit der Therapie organischer Beschwerden zu tun haben, können betriebsblind für einfache und häufige psychische Beschwerden sein.
Andersherum sind psychosomatische Probleme kein seltener Fall und können als Erkläransatz dazu führen, dass organische Ursachen für Krankheitssymptome übersehen werden. Dabei ist es weder unehrenhaft noch anderweitig schlecht, eine psychische Ursache zu vermuten: Gerade bei Schmerzpatienten und ihrem Erleben ist die Verknüpfung zwischen organischen Beschwerden, der psychischen Wahrnehmung von Schmerzen und der Chronifizierung in Verbindung mit Schmerzmittelgebrauch, der besonderen psychischen Belastung durch die Schmerzen und der damit verbundenen Einschränkungen im Leben so eng miteinander verknüpft, dass das Bündel nur schwer zu entwirren ist.
Auch Verdauungsbeschwerden haben häufig psychosomatische Ursachen – was aber nicht bedeutet, dass man andere Erklärungen vernachlässigen kann.
Wen betrifft das Problem übersehener Diagnosen?
Problematisch wird dies am Ende für Patienten, die keine Linderung ihrer Symptome erleben und dann eine Odyssee von Arzt zu Arzt starten, bis sie jemanden finden, der einen neuen Blickwinkel wagt. Die Kommunikation über diese Probleme ist beschwerlich: Patienten fühlen sich nicht ernst genommen oder mit psychischen Diagnosen abgewertet während der Arzt in der Beziehung zum Patienten einen erheblichen Wissensvorsprung hat und natürlich keinen Bedarf sieht, sich und seine Methoden ständig rechtfertigen zu müssen.
Die oben angeführten ökonomischen Erwägungen führen schließlich auch dazu, dass man pragmatische Medizin mitunter mit ökonomisierter und gewinnorientierter Medizin verwechseln kann. Ein großes Problem für die gewünschte Vertrauensbeziehung steht immer dann im Raum, wenn Ärzte oder Kliniken unter den Verdacht geraten, sich bereichern zu wollen, unnötige Behandlungen oder gar Operationen durchzuführen und finanziellen Erfolg über das Wohl der Patienten zu stellen.
Ein Gesundheitssystem, bei dem Kostenoptimierung dazu führt, dass wichtige diagnostische Werkzeuge nicht genutzt werden oder die Wahrscheinlichkeit bzw. Glaubwürdigkeit von Diagnosen der Abrechnung am Ende untergeordnet wird, verspielt am Ende die Tragfähigkeit der Beziehung zum Patienten.
Die Erosion dieses Vertrauens betrifft am Ende alle, wenn das Vertrauen der Bevölkerung in die Rechtschaffenheit und Wissenschaftlichkeit der Medizin verloren geht. Dies sorgt dafür, dass Arztbesuche hinausgezögert werden oder direkt windige Angebote unwissenschaftlicher Quacksalber bevorzugt werden. Am Ende führt dies im schlimmsten Fall dazu, dass lebensrettende Behandlungen zu spät begonnen werden, Patienten vor Therapien unnötig viel Leid erleben und die Effizienz und Sicherheit des gesamten Gesundheitssystems sinkt.
Schon aus diesem Grund sollte jeder Arzt seine Kenntnisse aktuell halten und sich insbesondere mit Erkrankungen beschäftigen, die oft übersehen werden.
Depressionen
Depressionen stehen hier stellvertretend für eine Menge von psychiatrischen Erkrankungen, über die aus sozialem Stigma heraus nicht gesprochen wird. Warum werden diese häufig nicht erkannt? Psychosomatik bedeutet, dass seelische Gesundheit sich derartig auf das körperliche Wohlbefinden auswirken kann, dass echte körperliche (somatische) Symptome entstehen.
Das allgemeine Nachlassen körperlicher Leistungsfähigkeit, Konzentrationsprobleme und das häufigere Auftreten von Schmerzen, sexuellen Funktionsstörungen, Schlafproblemen bis hin zu Herz-Kreislauf-Störungen kann eine Folge von Depressionen sein. Wer bei dieser Diagnose nur an schlechte Stimmung, Antriebslosigkeit oder Traurigkeit denkt, übersieht, wie breit sich die Erkrankung auf alle Lebensbereiche der Betroffenen auswirkt. Zudem sind Patienten darauf konditioniert, beim Hausarzt eher körperliche Beschwerden anzusprechen und über seelische Symptome hinwegzugehen.
Dabei handelt es sich bei Depressionen um eine teils schwerwiegende Erkrankung mit oft tödlichem Ausgang: Ihre Beteiligung an einer der häufigsten Todesursachen überhaupt ist nicht zu leugnen.
Bis vor einigen Jahren war die Ausbildung von Allgemeinmedizinern in Hinsicht auf das Fach der Psychiatrie sträflich vernachlässigt. Doch die Bedingungen haben sich geändert und das Engagement von Betroffenenverbänden und professionellen Vereinigungen führte dazu, dass das Erkennen von Depressionen in Weiterbildungen und Studium auch von Allgemeinmedizinern besser geschult wird.
Das Stigma auch in der Bevölkerung wurde zum Beispiel auch durch Prominente, die sich offen zu ihren Depressionen bekennen und über Symptome und Therapie berichten, abgebaut. Dies ist ein gesamtgesellschaftlicher Fortschritt von enormer Bedeutung.
Depression ist damit ein Beispiel für eine häufig übersehene Krankheit, bei der Aufklärung auf beiden Seiten wichtige medizinische Verbesserung bewirken konnte. Heute haben Betroffene einfacheren Zugang zu Therapien, bessere Chancen, mit ihren Symptomen wertschätzend aufgenommen und behandelt zu werden.
Endometriose
Die Endometriose ist eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen und wird dennoch oft übersehen: Etwa 10 bis 15 Prozent aller Mädchen und Frauen bzw. Menschen mit Gebärmutter sind betroffen. Die Ursache sind gutartige Tumore von der Gebärmutterschleimhaut, die außerhalb der Gebärmutter wachsen und z. B. auch mit dem Monatszyklus bluten. Sie verursacht Schmerzen, chronische Entzündungen, Vernarbungen im Bauchraum, Blutungen (auch in der Bauchhöhle) und ist stark zyklusabhängig.
Betroffene können durch die Erkrankung sogar unfruchtbar werden. Die Endometriose sorgt für erhebliche Beschwerden und auch psychische Belastung durch die immer wiederkehrenden Symptome. Da sie von Mensch zu Mensch unterschiedlich stark ausgeprägt und in den Beschwerden sehr wandelbar auftritt, ist die eindeutige Diagnose nur anhand der Patientengeschichte schwierig.
Zur Abklärung werden Untersuchungen mittels Spekulum, Abtastungen und Ultraschall verwendet, um die Zysten und Endometrioseherde aufzuklären. Am eindeutigsten ist die Laparoskopie (Bauchspiegelung).
Die Aufklärung über die Häufigkeit und Symptome der Erkrankung in der Bevölkerung ist immer noch unzureichend. Deswegen haben Betroffene immer noch Schwierigkeiten, einzuschätzen und zu kommunizieren, dass sie unter besonders starken Zyklusschmerzen leiden.
Neben dem Menstruationsstigma an sich ist auch die individuelle Einschätzung und der Vergleich von Schmerzerfahrungen sehr schwierig. Bei gewöhnlichen gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen ist der Befund oft unauffällig – erst wenn die Bauchhöhle außerhalb der Gebärmutter untersucht wird, entdeckt die Ärztin die Erkrankung.

Borreliose
Auch hier macht die Vielgestaltigkeit der Erkrankung Probleme. Borreliose ist eine bakterielle Erkrankung, die vor allem durch Zecken übertragen wird. Zwar findet man selten auch in Mücken Borrelienbefall, aber inwiefern dies zur Übertragung genügt, ist unklar. Begünstigend für die Übertragung durch Zecken ist der lange andauernde Fressvorgang der kleinen Parasiten, bei dem immer wieder der Blutfluss unterbrochen und Speichelsekret in die Wunde abgegeben wird.
Bis zu einem Drittel der Individuen der Art „Gemeiner Holzbock“ tragen die Erreger in sich. Je länger ein Biss unbemerkt bleibt, desto größer die Infektionsgefahr. Deswegen lohnt es sich nach Waldbesuchen aber auch Aufenthalten auf Wiesen den Körper gründlich abzusuchen.
Die akute Infektion mit Borrelien durchläuft mehrere Stadien, von denen das erste dasjenige mit der besten Chance auf Entdeckung ist: Bei vielen Betroffenen bildet sich hier die typische zielscheibenförmige Rötung (Wanderröte Erythema migrans). Die Therapie mit Antibiotika schlägt zu diesem Zeitpunkt noch gut an.
Doch dann versteckt sich der Erreger im Körper: Er kann zum Beispiel in Gelenkflüssigkeit, Nerven und auch der Rückenmarksflüssigkeit eindringen und schützt sich durch eine besondere Hülle, die ihn für das Immunsystem praktisch unerkennbar macht.
Es folgt eine mögliche Vielzahl von Symptomen: Gelenkbeschwerden, neurologische Beschwerden, Herzerkrankungen, Hautveränderungen und sogar die gefürchtete Neuroborreliose, eine Infektion des Zentralnervensystems. Im Verlauf vieler Jahre können auch Spätschäden entstehen, die nicht mehr im direkten Zusammenhang mit dem Erreger stehen müssen, sondern vermutlich eher als Folge von Autoimmunreaktionen entstehen.
Wenn die Wanderröte „verpasst“ wurde und kein Zeckenbiss erinnerlich ist, ist anhand des klinischen Bildes die Diagnose extrem schwierig. Der Erregernachweis gelingt bisher nicht zuverlässig und ist auch in spezifisch betroffenen Probenmaterialien (Liquor, Synovialflüssigkeit, Hautproben) wenig sensitiv. Jedoch kann im Blut meist ein erhöhter Antikörpertiter gegen Borrelien ermittelt werden – dies steht jedoch für einen Kontakt des Immunsystems zu Borrelien und muss kein Beweis für eine aktive Infektion sein.
Die Diagnose erfolgt also anhand von Indizien und aus dem Krankheitsbild in differentialdiagnostischer Abgrenzung zu anderen möglichen Erkrankungen. Das macht sie aufwändig und fehleranfällig.
Chronisches Erschöpfungssyndrom (ME/CFS)
Dies ist eine wenig bekannte und dennoch sehr verbreitete Krankheit: Der Name spricht schon vom Leitsymptom, der chronischen und starken Erschöpfung. Schon leichte körperliche oder geistige Anstrengungen können die Reserven der Betroffenen aufzehren und ihnen über lange Zeit die Kraft rauben, proaktiv zu werden.
Das heißt, nicht nur tritt Erschöpfung sehr rasch ein, sie hält auch besonders lange an. Dabei ist nach wie vor nicht klar, welche Ursache diese Beschwerden haben. Bisher wurden Fehlfunktionen des Nervensystems, des Immunsystems und des Hormonsystems identifiziert, zum grundlegenden Auslöser gibt es jedoch nur Vermutungen.
Die eingangs erwähnte Problematik der Abgrenzung von organischen zu psychosomatischen Beschwerden tritt hier besonders stark zutage. Betroffene berichten oft von ausführlichen Behandlungs- und Rehaversuchen auf Basis psychiatrischer Diagnosen, ehe sie mit ihren Symptomen „ernstgenommen“ werden. Dies soll nicht als Abwertung psychosomatischer Erkrankungen verstanden werden. Das damit verbundene gesellschaftliche Stigma heißt aus Perspektive der Patienten oft, dass sie für verrückt erklärt und abgeschoben werden, anstatt dass ihnen die Hilfe zukommt, die sie erhoffen.
Auch hier konnten anfängliche Erfolge durch Aufklärungskampagnen erreicht werden. Dennoch liegt die diagnostizierte Häufigkeit in der Bevölkerung Deutschlands bei 0,2 bis 0,4 Prozent, während Schätzungen von mindestens 1 Prozent Prävalenz ausgehen. Das bedeutet, dass diese Erkrankung mit massivem Leidensdruck immer noch sträflich übersehen wird.
Leider existiert immer noch keine wirksame ursächliche Therapie, weshalb vor allem symptomatisch behandelt werden muss. Entsprechende Konzepte basieren vor allem auf Psychoedukation und Antrainieren eines „Pacing“ genannten Kräftemanagements, mit dem die Betroffenen erlernen, entkräftende Anstrengungen zu vermeiden und die vorhandenen Reserven nicht zu überstrapazieren.
Seltene Erkrankungen
Besonders problematisch wird die korrekte Diagnose bei vielen seltenen Erkrankungen, da hier nicht nur die Ausbildung der Ärzte den Bedürfnissen der Patienten oftmals nicht gerecht wird, sondern vielfach sogar Forschungsgrundlagen und damit diagnostische Anleitungen fehlen.
Besonders tragisch ist für die Betroffenen, dass aus medizinökonomischen Gründen oftmals nur minimale Anstrengungen für Aufklärung und Therapie unternommen werden, da die Entwicklungskosten für spezialisierte Medikamente und Behandlungsmethoden scheinbar in keiner Relation zum gesamtgesellschaftlichen Gewinn stehen.
Damit sind seltene Erkrankungen nicht nur leicht zu übersehen. Wenn nach langer Odyssee festgestellt wird, was dem Patienten fehlt, kann keine adäquate medizinische Versorgung eingeleitet werden. Schlimmer noch: Auch die Auswirkungen symptomorientierter Therapien ist vielfach nicht ausreichend erforscht, sodass auf den ersten Blick wirksame Behandlungsansätze mitunter noch verschlimmernd wirken oder Komplikationen hervorrufen können.
Die medizinische Versorgung hat Nachholbedarf
Medizinische Versorgung für eine breite Bevölkerung bereitzustellen, ist eine gewaltige Aufgabe. Vielfach scheitern ärmere Staaten schon daran, allen Bürgern Zugang zu einer Grundversorgung zu garantieren. Dennoch bedeutet dies nicht, dass sich Industrienationen auf dem Erreichten ausruhen können.
Besonders bei häufigen Erkrankungen, die immer noch übersehen oder aufgrund gesellschaftlicher Stigmatisierung nicht ausreichend beachtet werden, besteht noch Nachholbedarf. Besonders bitter ist dagegen das Schicksal von Patienten bei seltenen Erkrankungen. Selbst wenn Therapien möglich wären, scheitert deren Entwicklung an hohen Kosten und dem damit verbundenen Risiko für Gesundheitsunternehmen.