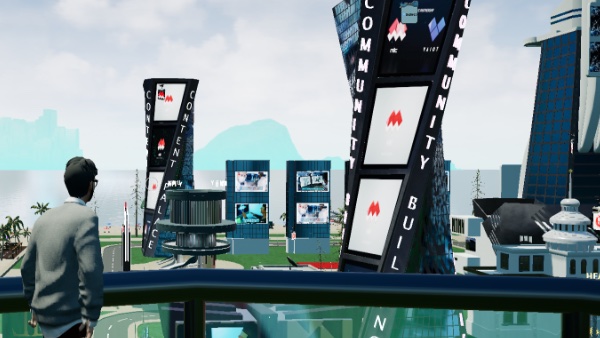Erst Wind, dann Bö und später Sandsturm
Bei einem Sandsturm werden lose Sandkörner vom Wind aufgewirbelt und über kilometerlange Strecken durch das Land transportiert. Entwickelt sich aber aus dem Wind eine kräftige Bö, droht ein Sandsturm. Dabei werden immer wieder neue Sandkörner aufgenommen, die sich zu einer größer und größer werdenden Staubwolke formieren. Vor allem in sehr trockenen und heißen Gegenden mit niedriger Luftfeuchtigkeit entstehen solche Sandtsunamis zwischen März und September.
Das australische Outback, der Mittlere Westen der USA, die Sahara, der Nahe Osten und auch die Wüstengebiete Ostasiens werden jährlich von riesigen Staubwolken mit bis zu hundert Millionen Tonnen Sand überrannt. Für die Bewohner dieser Regionen ist das keine Besonderheit. Doch die Sandstürme treten in den vergangenen Jahren immer häufiger und stärker auf als noch vor zehn Jahren.
Der Grund: Klimaveränderungen tragen dazu bei, dass Stürme und Winde zunehmen. Auch die steigende Verwüstung trockener Regionen ist dem Klimawandel zuzuschreiben.

Eine meterhohe Sandwolke rollt auf die Stadt Tesseney in Eritrea zu.

Die mehreren Hundert Meter hohen Sandwolken sind vor allem in trockenen und sehr heißen Regionen unserer Erde keine Seltenheit.

Ist der Wind sehr kräftig, kann ein Sturm aus Sand und Staub schon einmal achtzig bis hundert Stundenkilometer schnell werden. Manche Sandstürme sind sogar so groß, dass sie aus dem Weltall sichtbar sind.

Habubs, mit die gefährlichsten und stärksten Sandstürme, wüten vor allem in den Sahara-Regionen und im Südwesten der USA.

Auch Mittelasien wird von Sandstürmen wie den Buran in heißen Sommermonaten überrollt.

In den arabischen Ländern wütet vor allem der Chamsin. Dieser kann sogar mehrere Tage andauern.

In den US-Bundesstaaten Texas und Arizona sind Sandstürme im Sommer keine Besonderheit. Nähert sich ein Sandsturm jedoch einer Stadt kann das verheerende Folgen haben.

Sandtsunamis hinterlassen in Städten zentimeterdicke Staubschichten. Die Folgen: Getriebe und Motoren werden durch die kleinen Sandkörner beschädigt. Außerdem: Die ganze Stadt ist eingestaubt und dreckig.

Gefährlich werden Sandstürme vor allem für Autofahrer: Ziehen sie über Straßen, kann es zu schlimmen Auffahrunfällen kommen.

Doch Sandstürme haben auch ihre guten Seiten: Für die Natur wirkt der Sand wie ein Dünger.
Die Zahl der Sandstürme steigt weltweit an
Der stärkste und gefährlichste Sandsturm ist der Habub in der Sahara-Region und im Südwesten der USA. Dieser kann Geschwindigkeit von bis zu achtzig Kilometer pro Stunde erreichen und Sand bis zu einem Kilometer Höhe aufwirbeln. Vor allem zwischen Mai und September treten Habubs auf, da der Wind auf trockene Luft stößt und gigantische Mengen an Sand aufwirbelt.
Nicht nur Habubs können erhebliche Schäden anrichten, auch der Buran, ein starker Sturm in Asien, sucht häufig die chinesische Hauptstadt Peking heim. Wetterexperten der chinesischen Akademie der Wissenschaft schätzen, dass sich die Zahl der Sandstürme in China in den letzten fünfzig Jahren auf das sechsfache erhöht hat.
Meist dauern die gewaltigen Sandstürme mehrere Stunden an, einige können sogar Tage andauern – so unter anderem der Kamsin, der in den arabischen Ländern wie Libyen, Ägypten, Israel, Syrien, Kuwait und Libanon riesige Massen an Sand bewegt und das Wüstenbild dadurch immer wieder stark verändert. Besonders gefährlich wird es, wenn Sandstürme über Städte hinwegziehen. Gebäude, Straßen und Autos werden von zentimeterdicken Staubschichten überdeckt.
Die Sicht kann so schlecht werden, dass Autofahren unmöglich wird. Sandkörner verfangen sich in Motoren und Getriebe, richten erheblichen Schaden an und bringen die Industrie zum Stillstand.
2011 sorgte ein Sandsturm in Deutschland für Verwüstung
Nicht nur in den Wüstenregionen unserer Erde gibt es Sandstürme – auch in Deutschland wüten die staubigen Winde. 2011 verursachte ein Sandsturm auf der Autobahn zwischen Rostock und Güstrow eine Massenkarambolage, acht Menschen starben.
Schuld war ein Sturm von der Küste, der sich ungewöhnlich weit ins Binnenland hereingezogen hatte. Staub und trockene Erde auf den Feldern wurden vom Wind aufgewirbelt und eine riesige Staubwolke legte sich über die Fahrbahn. Dutzende Autos rasten ineinander und verursachten einen der größten Massenunfälle Deutschlands.
Allerdings hat der aufgewirbelte Sand auch seine guten Seiten: Der afrikanische Wüstensand dient zum Beispiel Korallenriffen und Regenwäldern als natürlicher Dünger.
Auch das Algenwachstum wird durch ihn begünstigt und bietet Meeresbewohnern eine weitere Nährquelle. Die mineralstoffreichen Sandkörner aus den Wüsten dieser Welt begünstigen unter anderem das Pflanzenwachstum im Amazonas.
Saharastaub besteht aus weit gereisten feinen Partikeln
Sandstürme und Saharastaub sind jedoch zwei unterschiedliche Phänomene. Saharastaub wird von starken Südwinden aus der größten Trockenwüste der Welt in Nordafrika hoch in die Luft gewirbelt und kann Tausende von Kilometern nach Norden getragen werden. Rund eine Milliarde Tonnen Sand trägt der Wind jährlich aus der Sahara. Bei uns landet nur ein Bruchteil davon – mehr gelangt auf die Kanarischen Inseln und nach Südamerika.
Meist breitet sich der Saharastaub in höheren Luftschichten aus. Er wird daher nur von Meteorologen registriert. Zu Auswirkungen wie jetzt kommt es erst, wenn die Sandpartikel in Bodennähe gelangen. Damit einher geht nach Expertenmeinung auch eine erhöhte Feinstaubbelastung. Vor allem im Frühjahr und Herbst ist Saharastaub häufig in der Atmosphäre zu finden. Die derzeitige Intensität in Europa gilt jedoch als ungewöhnlich.
Warum sich Saharastaub auf unseren Autos niederlässt
Saharastaub besteht aus feinen Sandkörnern und mineralischen Staubpartikeln, die rau genug sind, um Oberflächen zu zerkratzen. Diese winzig kleinen Teilchen werden als als Aerosol in die Atmosphäre transportiert. Sie bestehen aus Alumosilikaten, Eisenoxiden, Quarz, Calcit und Gips, wobei die Eisenoxide den Staub magnetisch machen können. Dies sorgt für die unbeliebte Eigenschaft des Saharastaubs, sich an Autos, Fahrrädern und weiteren metallischen Oberflächen festzusetzen. Zudem können sie auf ihrer Oberfläche sogar Krankheitskeime mit sich führen.